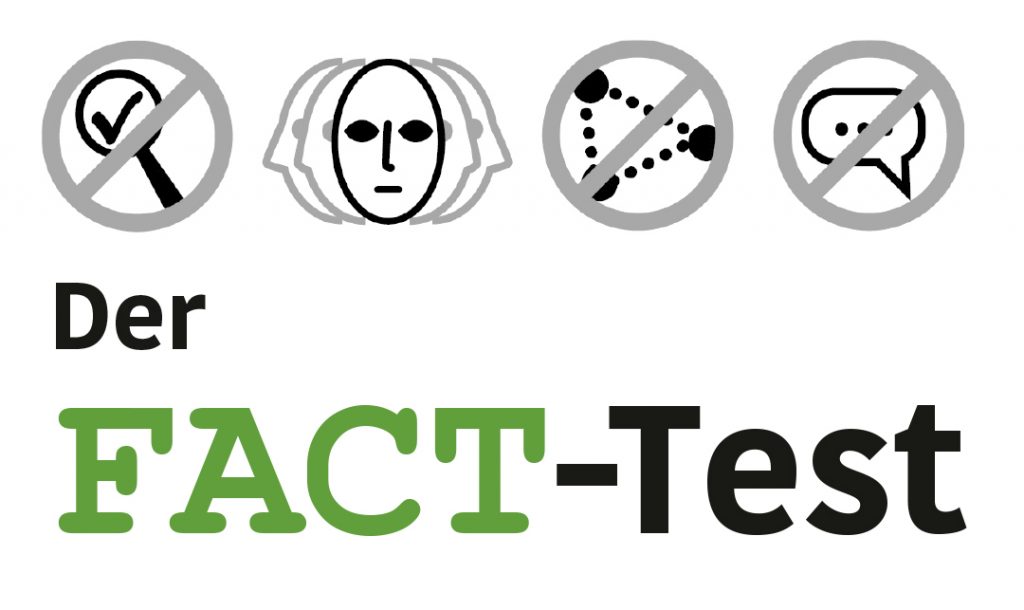Pro-israelische Verzerrungen folgen einem Muster. Entlarve es mit dem Fact-Test!
Für einen fairen Diskurs.
Untersuchungen zeigen:
Manipulative Methoden kommen leider immer wieder zum Einsatz, um die Rolle des Zionismus und der israelischen Politik im Nahostkonflikt zu verharmlosen, zu beschönigen oder ganz auszublenden.
Dies geschieht in Verlautbarungen von Politiker*innen, in der medialen Berichterstattung, aber auch in Publikationen staatlicher Bildungsinstitutionen (Bundeszentrale für politische Bildung, Landeszentralen für politische Bildung), im Informationsmaterial von Stiftungen und NGOs, in Erklärvideos und Unterrichtsmaterialien.
Der FACT-Test wurde entwickelt, um solche unfairen Strategien sichtbar zu machen und ihnen mit Klarheit, Systematik und Argumentationssicherheit zu begegnen.
Wofür steht das Akronym FACT?
F steht für Fact Suppression / Faktenunterdrückung
A steht für Attention Shift / Ablenkung
C steht für Context Ignored / Kontextausblendung
T steht für Taboo Enforcement / Tabuisierung
Was ist genau gemeint?
Im Folgenden listen wir Beispiele auf. Um sie zu auszuklappen, bitte auf das Pfeilchen klicken.

Fact Suppression / Faktenunterdrückung
Wissenschaftliche Erkenntnisse, belegte Tatsachen oder historische Quellen werden systematisch ausgeblendet, wenn sie nicht ins gewünschte Narrativ passen.
Beispiele für unterdrückte Fakten
Zionismus zielt auf die Verdrängung der Palästinenser ab
Verschwiegen wird dabei das zentrale Ziel des Zionismus, auf dem zu besiedelnden Gebiet eine jüdische Bevölkerungsmehrheit zu schaffen. Historisch belegte Pläne und Maßnahmen zur Verdrängung der palästinensischen Bevölkerung werden ausgeblendet – von Herzls Tagebucheinträgen über die Landkäufe des Jewish National Fund ab 1907, von der Einrichtung von Transfer-Komitees in den 1930er Jahren, Ben-Gurions Forderung nach einer jüdischen Mehrheit von mindestens 80 Prozent (1947), den Vertreibungen und Massakern während der Nakba, der systematischen Zerstörung von 400 bis 600 palästinensischen Dörfern, der Enteignung und Umbenennung von Orten, der Ablehnung des Rückkehrrechts, den erneuten Vertreibungen während der Naksa 1967, der jahrzehntelangen Besatzung bis hin zu aktuellen ethnischen Säuberungen etwa im Westjordanland und Gazastreifen. Die Zerschlagung der palästinensischen Gesellschaft und die anhaltende Verweigerung grundlegender Rechte zielen noch heute darauf ab, die palästinensische Bevölkerung zum Auswandern zu bewegen.
Die Mehrheit der Jüdinnen und Juden lehnten den Zionismus lange ab
Es wird verschwiegen, dass der Zionismus bis in die 1940er Jahre nur von einer Minderheit der Jüdinnen und Juden aktiv unterstützt wurde. Die Idee, nach Palästina zu ziehen, stieß in der jüdischen Bevölkerung auf großen Widerstand. Selbst unter dem Terror des NS-Regimes versuchten die meisten, in die USA, nach Großbritannien, Frankreich, Portugal oder andere Länder zu fliehen – Palästina war für die Mehrheit keine bevorzugte Option. Erst als die Fluchtwege zunehmend versperrt wurden, rückte Palästina für einige überhaupt in den Blick.
Es gab und gibt einen jüdischen Antizionismus
Ein weiterer oft ausgeblendeter Fakt ist der jüdische Antizionismus, der von Beginn an bis heute existiert. Viele Jüdinnen und Juden – von orthodoxen religiösen Autoritäten bis zu liberalen und sozialistischen Strömungen – lehnten den Zionismus ab, weil sie ihn als nationalistisch, spalterisch oder gar als Verrat an religiösen und universalistischen Werten betrachteten. Auch nach der Staatsgründung Israels blieb jüdischer Antizionismus in unterschiedlichen Ausprägungen lebendig, wird jedoch im öffentlichen Diskurs meist marginalisiert oder als randständig dargestellt. Dabei gehört diese Vielfalt an jüdischen Stimmen untrennbar zur Geschichte und Gegenwart des Judentums.
Palästina war für die Zionisten anfangs nur eine von mehreren Optionen
Ein oft unterschlagener Punkt ist, dass sich die zionistische Bewegung anfangs keineswegs einig war, Palästina als Zielgebiet jüdischer Besiedlung zu wählen. Auch andere Länder wie Argentinien oder ein von Großbritannien vorgeschlagenes Gebiet in Ostafrika (Uganda-Plan) wurden ernsthaft diskutiert. Die Entscheidung für Palästina setzte sich erst allmählich durch und war keineswegs selbstverständlich – selbst unter den zionistischen Vordenkern. Dies zeigt, dass die vielbeschworene Sehnsucht nach einer „Rückkehr ins Heilige Land“ eher ein nachträglich verfestigter Mythos als ein durchgängiges Motiv der frühen Bewegung war.
Zionisten übernahmen antisemitische Vorstellungen
Ein Aspekt, der nahezu immer verschwiegen wird, ist die Übernahme antisemitischer Stereotype durch zionistische Vordenker. So teilten viele frühe Zionisten die Überzeugung der Antisemiten, dass Juden ein Fremdkörper in ihren Heimatländern seien und grundlegender Veränderung bedürften. Daraus entstand das zionistische Ideal des „neuen, starken Juden“, der sich bewusst von den als schwach oder dekadent geltenden Diaspora-Juden abgrenzen sollte. Diese Selbststilisierung wurde propagandistisch verbreitet und durch konkrete Maßnahmen gefördert – bis hin zum heutigen Bild des kräftigen, wehrhaften IDF-Soldaten. Die Tatsache, dass der Zionismus damit antisemitische Denkmuster übernahm, bleibt im öffentlichen Diskurs fast immer unerwähnt.
Rassismus war und ist Teil der zionistischen Ideologie
Ein Aspekt, der im öffentlichen Diskurs fast immer verschwiegen wird, ist der offene Rassismus vieler zionistischer Vordenker gegenüber der palästinensischen Bevölkerung. Der Slogan „Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land“, von Israel Zangwill popularisiert, blendete die Existenz der dort lebenden Menschen bewusst aus – obwohl Zangwill wusste, dass Palästina bewohnt war. Dieser rassistische Blick richtete sich nicht nur gegen arabische Palästinenser, sondern auch gegen palästinensische Jüdinnen und Juden, die von vielen europäischen Zionisten als „orientalisch“ und minderwertig abgewertet wurden. Solche rassistischen Einstellungen und Hierarchien werden bis heute im Mainstream-Diskurs meist ausgeklammert, sind aber zentral für das Verständnis der historischen und aktuellen Entwicklungen.
Die zionistische Ideologie steht im Widerspruch zu den Werten des Judentums
Ein verschwiegenes Thema ist, dass die zionistische Ideologie zentrale jüdische Werte wie Barmherzigkeit, Selbstkritik und die Achtung des Fremden missachtet. Viele religiöse und säkulare Jüdinnen und Juden lehnten und lehnen den Zionismus deshalb ab, weil er nationale Selbstbehauptung und Gewalt über die ethischen Prinzipien der jüdischen Tradition stellte. Dieser grundlegende Widerspruch wird im öffentlichen Diskurs meist ausgeklammert.
Der Zionismus ist eine siedlerkoloniale Ideologie
In der deutschen Debatte wird meist ausgeblendet, dass der Zionismus ein klassisches siedlerkoloniales Projekt ist. Zionistische Siedler kamen ab Ende des 19. Jahrhunderts nach Palästina, um dort ein eigenes, souveränes Gemeinwesen zu errichten – und zwar auf Kosten der bereits ansässigen Bevölkerung. Ziel war es, möglichst viel Land mit möglichst wenigen Arabern zu besiedeln und eine jüdische Mehrheit zu schaffen. Diese Logik prägte von Anfang an die zionistische Bewegung und ist zentral für das Verständnis der anhaltenden Konflikte und der bis heute bestehenden Ungleichheiten zwischen jüdischen Israelis und Palästinensern.
Dass der Zionismus damit in einer Linie mit anderen Siedlerkolonialismen wie in Nordamerika, Australien oder Südafrika steht, wird in der deutschen Öffentlichkeit fast nie benannt – obwohl diese Perspektive in der internationalen Forschung längst etabliert ist.
Die Nakba begann schon 1947 und war Teil der zionistischen Strategie
Ein zentraler Punkt, der in der deutschen Debatte fast immer verschwiegen wird, ist, dass die Nakba nicht erst mit dem israelischen Unabhängigkeitskrieg begann, sondern bereits 1947 einsetzte. Noch vor der Staatsgründung Israels wurden zahlreiche palästinensische Ortschaften angegriffen, viele davon zerstört, und rund 300.000 Palästinenserinnen und Palästinenser vertrieben. Auch das berüchtigte Massaker von Deir Yassin am 9. April 1948, bei dem über hundert Dorfbewohner brutal ermordet wurden, ereignete sich vor der Staatsgründung. Diese frühen Verbrechen werden häufig ausgeblendet oder in einen Kriegskontext gestellt, um sie zu relativieren und die Verantwortung zu verschleiern. Tatsächlich aber waren systematische Vertreibung und Gewalt gegen die palästinensische Bevölkerung bereits vor dem offiziellen Kriegsbeginn Teil der zionistischen Strategie.
Die Teilungspläne und Lösungsvorschläge waren/sind inakzeptabel
In der deutschen Debatte wird stets verschwiegen, dass die Ablehnung von Teilungs- und Friedensplänen durch die Palästinenser gute Gründe hatte. Die frühen Teilungspläne, wie der UN-Teilungsplan von 1947, sahen vor, dass den jüdischen Neuankömmlingen mehr als die Hälfte des Landes zugesprochen wird, obwohl sie damals nur etwa ein Drittel der Bevölkerung stellten und einen winzigen Bruchteil des Landes besaßen.
Spätere Angebote, wie die Vorschläge von Camp David im Jahr 2000, hätten keinen souveränen palästinensischen Staat ermöglicht, sondern ein zersplittertes, von israelischer Kontrolle durchzogenes Gebiet ohne wirkliche Unabhängigkeit. Die Tatsache, dass diese Angebote für die Palästinenser unannehmbar waren, wird im öffentlichen Diskurs meist verschwiegen – stattdessen wird ihre Ablehnung als Beweis für Kompromisslosigkeit dargestellt.
Israel sabotiert die Zweistaatenlösung und einen dauerhaften Frieden
Ein oft verschwiegenes Faktum ist, dass Israel eine Zweistaatenlösung systematisch behindert. Die fortgesetzte, völkerrechtswidrige Besiedlung des Westjordanlands – trotz internationaler Verurteilung – macht einen zusammenhängenden palästinensischen Staat faktisch unmöglich. Gleichzeitig hat Israel über Jahre hinweg die Spaltung der Palästinenser gefördert, etwa durch die indirekte Unterstützung der Hamas, um die PLO zu schwächen. Beide Strategien untergraben gezielt die Voraussetzungen für eine gerechte Lösung und damit einen dauerhaften Frieden – was im öffentlichen Diskurs kaum thematisiert wird.
Die militärische Vergangenheit israelischer Spitzenpolitiker
Ein Aspekt, der in der deutschen Debatte fast immer ausgeblendet wird, ist die militärische Vergangenheit zahlreicher israelischer Spitzenpolitiker – oft mit direkter Verantwortung für Kriegsverbrechen oder Massaker. Menachem Begin war als Anführer der Irgun politisch verantwortlich für das Massaker von Deir Yassin 1948. Yitzhak Rabin war als Militärbefehlshaber an der Vertreibung von Palästinensern während des Kriegs von 1967 beteiligt. Ariel Sharon wurde von der Kahan-Kommission eine politische Mitverantwortung für das Massaker von Sabra und Schatila 1982 zugewiesen. Benjamin Netanjahu diente in der Eliteeinheit Sayeret Matkal, die für zahlreiche umstrittene und völkerrechtswidrige Operationen bekannt ist; aktuell steht er als Regierungschef wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen unter internationalem Haftbefehl. Diese persönlichen Verstrickungen in Gewalt und Menschenrechtsverletzungen werden in der deutschen Öffentlichkeit meist verschwiegen.
Israel verstößt gegen Völkerrecht
Ein entscheidender Punkt, der in der deutschen Debatte oft ausgeblendet wird, ist die völkerrechtliche Bewertung des israelischen Handelns. Während medial häufig Begriffe wie „Selbstverteidigung“ oder „Existenzrecht Israels“ dominieren, bleibt die Einschätzung durch die UN, den Internationalen Gerichtshof (IGH) und zahlreiche Völkerrechtler meist unerwähnt. Der IGH hat erst im Juli 2024 festgestellt, dass die israelische Besatzung und Siedlungspolitik im Westjordanland, Ostjerusalem und Gaza klar gegen das Völkerrecht verstoßen – insbesondere gegen das Verbot der gewaltsamen Aneignung fremden Gebiets und das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser. Israel wurde verpflichtet, die Besatzung zu beenden, alle Siedlungen zu räumen und Reparationen zu leisten. Diese klaren völkerrechtlichen Feststellungen werden in der deutschen Medienlandschaft jedoch kaum diskutiert. Auch im Kontext der israelischen Angriffe auf den Iran dominieren nationale und israelische Stimmen, die Israels Vorgehen rechtfertigen, während völkerrechtliche Kritik weitgehend ausgeblendet bleibt.
Es gibt auch palästinensische „Geiseln“
Ein wichtiger Punkt, der in der deutschen Debatte meist ausgeblendet wird, ist die Situation der palästinensischen Gefangenen in israelischer Haft. Während die israelischen Geiseln viel mediale Aufmerksamkeit erhalten, wird kaum thematisiert, dass zehntausende Palästinenser – darunter viele Minderjährige – oft auf Grundlage des sogenannten „Administrativhaft“-Verfahrens festgehalten werden. Diese Inhaftierungen erfolgen häufig ohne Anklage oder Gerichtsverfahren und können beliebig verlängert werden, was von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International seit Jahren als willkürliche Freiheitsberaubung und Verstoß gegen internationale Standards kritisiert wird.
Im Rahmen von Geiselabkommen hat Israel in den vergangenen Monaten Hunderte palästinensische Gefangene freigelassen, viele davon waren nach Militärrecht und ohne ordentliches Verfahren verurteilt oder festgehalten worden. Für viele Palästinenser und internationale Beobachter sind diese Gefangenen faktisch „politische Geiseln“, da ihre Festnahme und Haftbedingungen oft als Druckmittel im Konflikt eingesetzt werden. Dieser Aspekt bleibt im öffentlichen Diskurs meist unerwähnt, obwohl er für das Verständnis der Dynamik und der Ungleichheit im Konflikt zentral ist.
Alle israelischen Regierungen hatten territoriale Expansion im Sinn
Ein oft ausgeblendeter Aspekt ist, dass das Ziel territorialer Expansion nicht erst mit rechten oder nationalreligiösen Regierungen aufkam, sondern bereits die sozialdemokratische Mapai-Regierung unter Ben-Gurion nach 1948 verfolgte. Führende Mapai-Politiker äußerten Bedauern darüber, im Unabhängigkeitskrieg nicht mehr Land erobert zu haben, und betrachteten die 1949 gezogenen Waffenstillstandslinien nie als endgültige Grenze. Auch in den Jahrzehnten danach blieb die schrittweise Ausdehnung israelischer Kontrolle – ob durch Siedlungen, Landenteignungen oder militärische Präsenz – ein überparteiliches Ziel. Die heutige Siedlungspolitik steht somit in einer langen Tradition, die von allen politischen Lagern getragen wurde, auch wenn sie früher weniger offen kommuniziert wurde als heute.

Attention Shift / Ablenkung
Von wichtigen Aspekten wird abgelenkt, indem man andere Themen in den Vordergrund stellt.
Beispiele für Ablenkungsmanöver
Die Ablenkungsstrategie der inszenierten Komplexität
Die künstliche Überhöhung der „Komplexität“ des Nahostkonflikts ist eine gängige Ablenkungs- und Einschüchterungsstrategie: In Unterrichtsmaterialien, Medien und öffentlichen Debatten wird häufig ein verwirrender historischer Bogen gespannt – von biblischen Zeiten bis heute –, der den eigentlichen Kern des Konflikts verschleiert. Wer sich in diesen Details verliert, stellt kaum noch kritische Fragen. Dabei ist die zentrale Ursache klar benennbar: das zionistische Projekt, in einer mehrheitlich von Nicht-Juden bewohnten Region eine jüdische Mehrheitsgesellschaft zu schaffen, und die Bereitschaft, dieses Ziel mit systematischer Vertreibung, Entrechtung und Gewalt völkerrechtswidrig durchzusetzen. Die Inszenierung von Komplexität dient so nicht der Aufklärung, sondern der Entpolitisierung und Einschüchterung – und lenkt gezielt von Verantwortung und den realen Machtverhältnissen ab.
Gezielte Ablenkung vom historischen IGH-Gutachten (19. Juli 2024)
Trotz der historischen Tragweite des IGH-Gutachtens vom 19. Juli 2024, das Israels Besatzung und Siedlungspolitik eindeutig als völkerrechtswidrig verurteilt, blieb die Berichterstattung in den Leitmedien auffallend oberflächlich. Statt eine breite, vertiefte Auseinandersetzung mit den Konsequenzen dieses richtungsweisenden Urteils zu führen, dominierten aktuelle Konfliktereignisse, politische Reaktionen und vor allem Klarstellungen zu vereinzelten Falschbehauptungen in Sozialen Medien die Nachrichtenlage. Besonders irritierend: Während monatelange Proteste von Menschenrechtsaktivisten kaum Beachtung fanden, wurde am Tag des Gutachtens viel Raum darauf verwendet, kursierende Fehlinformationen in Faktenchecks zu zerlegen. Für den Mediennutzer entsteht so der Eindruck, das Gutachten sei nebensächlich und übertrieben interpretiert worden, während Israel sich im „grünen Bereich“ bewege – eine klassische Ablenkungsstrategie, die die eigentliche historische Bedeutung des IGH-Urteils aus dem Fokus rückt.
Bewunderung statt völkerrechtlicher Einordnung der israelischen Pager-Attacke
Die Berichterstattung über die Pager-Attacke vom 17. September 2024 verdeutlicht das Muster gezielter Ablenkung: Während israelische Geheimdienste Tausende präparierte Pager im Libanon explodieren ließen – mit mindestens 37 Toten und rund 3.000 Verletzten, darunter auch Zivilisten –, lag der Fokus vieler Medien auf der technischen Raffinesse des Mossad oder der psychologischen Kriegsführung. Dabei ist die völkerrechtliche Bewertung eindeutig: Die gezielte Tötung von Menschen ohne Gerichtsverfahren, außerhalb unmittelbarer Kampfhandlungen und unter Inkaufnahme ziviler Opfer, verstößt klar gegen das humanitäre Völkerrecht und stellt nach den Genfer Abkommen sowie UN-Prinzipien eine außergerichtliche Hinrichtung und damit ein Kriegsverbrechen dar. Dennoch wurde dieser Aspekt in der öffentlichen Debatte weitgehend ausgeblendet und stattdessen die „Genialität“ der Operation hervorgehoben. Diese Ablenkung dient dazu, Israel vor einem Imageschaden zu bewahren.
Gezielte Überbetonung der Religion
Der Nahostkonflikt ist kein Religionskrieg, sondern ein territorialer Konflikt um Land und Selbstbestimmung. Zwar wird die Hamas oft als „radikalislamisch“ bezeichnet, doch der Widerstand richtet sich vor allem gegen Besatzung und Entrechtung – unabhängig von Religion. Historisch waren viele palästinensische Gruppen säkular, und die Einschränkungen betreffen Muslime, Christen und andere gleichermaßen. Die Betonung des religiösen Aspekts lenkt vom Kern des Konflikts ab und soll legitime politische Forderungen diskreditieren.
Die unsinnige Fokussierung auf arabische Nachbarstaaten
Der Verweis auf die arabischen Nachbarländer als angebliche „Verweigerer“ palästinensischer Flüchtlinge ist ein klassisches Ablenkungsmanöver: Erstens stimmt es so pauschal nicht – allein Jordanien hat rund 2,4 Millionen palästinensische Flüchtlinge aufgenommen, auch im Libanon und Syrien leben Hunderttausende. Zweitens verschiebt diese Argumentation die Verantwortung und lenkt vom eigentlichen Problem ab: der systematischen Entrechtung, Vertreibung und Gewalt durch Israel. Es ist nicht Aufgabe der Nachbarländer, die Folgen von Vertreibung und ethnischer Säuberung zu „lösen“, indem sie die Opfer dauerhaft aufnehmen. Wer die Debatte auf die Rolle der arabischen Staaten verengt, entlastet Israel von seiner Verantwortung und verwässert die zentrale Frage nach Gerechtigkeit, Rückkehrrecht und Selbstbestimmung der Palästinenser.
Befindlichkeiten als Ablenkungsmanöver von massenhaftem Sterben
Der mediale Fokus auf die Unsicherheitsgefühle pro-zionistischer jüdischer Studierender an deutschen Universitäten ist ein weiteres Ablenkungsmuster: Solche Berichte werden regelmäßig prominent platziert, während ausgeblendet bleibt, dass viele jüdische Aktivistinnen und Aktivisten solidarisch an der Seite palästinasolidarischer Gruppen stehen und sich dort sicher und akzeptiert fühlen. In Demonstrationen und Hochschulgruppen sind jüdische Stimmen gegen Israels Politik sichtbar und engagiert, doch diese Perspektiven finden kaum Eingang in die Berichterstattung. Stattdessen werden vereinzelte, oft orchestriert wirkende Wortmeldungen aufgebauscht, um eine Atmosphäre der Bedrohung zu suggerieren. Das verschiebt die Aufmerksamkeit weg von den realen, massiven Menschenrechtsverletzungen und zivilen Opfern in Gaza, im Westjordanland und anderen Konfliktregionen – dort, wo Menschen nicht nur Angst empfinden, sondern tatsächlich zu Tausenden von israelischen Streitkräften getötet werden. Diese selektive Thematisierung emotionalisiert die Debatte in Deutschland und lenkt gezielt von der politischen und humanitären Katastrophe im Nahen Osten ab.
Demokratie-Mythos als Ablenkung von Apartheidvorwürfen
Der Apartheid-Vorwurf gegen Israel wird in der öffentlichen Debatte häufig mit dem Hinweis abgetan, Israel sei die „einzige Demokratie im Nahen Osten“ und palästinensische Israelis hätten gleiche Rechte wie jüdische Bürger. Diese Darstellung verschweigt jedoch die von Amnesty International, Human Rights Watch und zahlreichen weiteren Organisationen dokumentierte, systematische Diskriminierung: Ein komplexes Geflecht aus Gesetzen und Praktiken verhindert seit Jahrzehnten die tatsächliche Gleichstellung palästinensischer Bürger, etwa durch Einschränkungen beim Zugang zu Land, Ressourcen, politischer Teilhabe und Familienzusammenführung.Die wenigen Beispiele von Palästinensern mit öffentlichen Ämtern oder beruflichem Erfolg dienen als Feigenblatt und lenken von der institutionellen Ausgrenzung ab. Die internationale Forschung und das IGH-Gutachten bestätigen: Es existiert ein umfassendes System der Ungleichbehandlung, das dem Apartheidbegriff nach internationalem Recht entspricht – ungeachtet einzelner Erfolgsgeschichten.
Ablenkende Strohmann-Taktik auf Kosten der Wahrhaftigkeit
Ein typisches Ablenkungsmuster im Diskurs um Palästina ist der Einsatz von Strohmannargumenten, etwa beim Slogan „From the river to the sea, Palestine should be free“. Obwohl viele Demonstrierende und Rednerinnen ausdrücklich betonen, dass sie damit gleiche Rechte und Freiheiten für alle Menschen zwischen Jordan und Mittelmeer fordern – unabhängig von Herkunft, Religion oder Identität –, wird der Slogan regelmäßig als Aufruf zur „Vernichtung Israels“ oder gar zum „Genozid an Jüdinnen und Juden“ umgedeutet. Medienberichte und politische Stellungnahmen greifen diese Deutung immer wieder auf, etwa wenn Bundespolitiker pauschal von „antisemitischer Hetze“ sprechen oder Polizeibehörden Demonstrationen mit Verweis auf angebliche Gewaltaufrufe verbieten. Dabei werden die tatsächlichen Aussagen und Intentionen der Protestierenden systematisch ignoriert. Diese Strohmannstrategie lenkt gezielt von den eigentlichen Forderungen nach Gleichberechtigung und Menschenrechten ab und verhindert eine sachliche Auseinandersetzung mit den Zielen der palästinasolidarischen Bewegung.
Taktische Umdeutung von Kritik als Ablenkung von aktuellen Kriegsverbrechen
Ein gängiges Ablenkungsmuster ist die Umdeutung konkreter Vorwürfe als antisemitische Tropen. So wird etwa ein Protestbanner mit der Aufschrift „Kindermörder Israel“ manipulativ mit mittelalterlichen „Kindermord“-Mythen in Verbindung gebracht, anstatt als Anklage gegen reale Kriegsverbrechen verstanden zu werden.
Tatsächlich belegen internationale Organisationen wie UNICEF und OCHA, dass im Gazastreifen seit Oktober 2023 über 15.000 Kinder durch israelische Angriffe getötet wurden. Ärzteorganisationen wie „Ärzte ohne Grenzen“ und der „Palestinian Red Crescent“ berichten zudem, dass zahlreiche Kinder gezielt von israelischen Soldaten und Drohnen in Kopf und Torso getroffen wurden. Diese Zahlen und Berichte sind international dokumentiert und werden auch von israelischen Quellen nicht grundsätzlich bestritten.
Die taktische Umdeutung solcher Slogans verschiebt die Debatte von belegten Verbrechen auf abstrakte historische Vorwürfe. So werden legitime Anklagen delegitimiert und Protestierende pauschal als Antisemiten diffamiert – eine Strategie, die Kritik entwertet und von der Realität ablenkt.
Der konstruierte Antisemitismusvorwurf um den Begriff ‚Israelkritik‘ als Ablenkung
Das Argument, es gebe nur „Israelkritik“ aber keine „Russlandkritik“ oder „Irankritik“, dient als Ablenkung von der inhaltlichen Auseinandersetzung: Der Begriff „Israelkritik“ existiert vor allem deshalb, weil Kritiker*innen sich gegen den Vorwurf des Antisemitismus absichern müssen – ein Vorwurf, der bei anderen Staaten nicht erhoben wird. Niemand käme auf die Idee, Kritik an Russland als Slawenhass oder Kritik an Norwegen als Skandinavierhass zu deuten. Gerade dieser Vergleich macht die Absurdität und Willkür deutlich: Wer den Begriff „Israelkritik“ als Beleg für antisemitische Motive anführt, lenkt gezielt von den eigentlichen Fakten und Argumenten ab und delegitimiert Kritik, ohne sich mit ihren Inhalten auseinanderzusetzen.
Whataboutismus als Ablenkungsstrategie
Whataboutism ist ein häufiges Ablenkungsmuster in der Israel-Palästina-Debatte: Kritik an israelischer Politik wird regelmäßig mit dem Verweis auf Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern wie Syrien, Iran oder Russland relativiert („Warum redet ihr nicht über…?“). Diese Strategie lenkt gezielt von der aktuellen Kritik ab, verhindert eine sachliche Auseinandersetzung mit konkreten Vorwürfen und erschwert eine konstruktive Debatte.
Ablenkung durch Delegitimierung und Etikettierung
Ein verbreitetes Ablenkungsmuster ist die Delegitimierung durch Etikettierung: Kritische Stimmen wie Francesca Albanese, Ilan Pappe, Norman Finkelstein, die jüdische Menschenrechtsgruppe „Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost“ oder die israelische Veteranenorganisation „Breaking the Silence“ werden pauschal als „israelfeindlich“, „antisemitisch“ oder „extremistisch“ abgestempelt. So wird ihre fundierte Expertise diskreditiert und ihre Argumente werden aus dem Diskurs gedrängt – anstatt sich mit den belegten Fakten und Analysen auseinanderzusetzen, lenkt diese Strategie gezielt von der inhaltlichen Kritik ab.

Context Ignored / Kontextausblendung
Historische, gesellschaftliche oder politische Hintergründe werden gezielt ausgeblendet. Man tut so, als hätte die Geschichte zu einem bestimmten Zeitpunkt begonnen – alles, was davor geschah, wird unterschlagen. So wirken Kritik, Widerstand oder bestimmte Ereignisse, als kämen sie „aus dem Nichts“.
Beispiele für das Ausblenden von Kontexten
Kontextausblendung: Die (andauernde) Nakba
Häufig wird die Nakba auf das Jahr 1948 und die israelische Staatsgründung reduziert, obwohl Vertreibungen, Massaker und die gezielte Einschüchterung der palästinensischen Bevölkerung bereits zuvor begannen. Ein zentrales Beispiel ist das Massaker von Deir Yassin am 9. April 1948: Zionistische Milizen der Irgun und Lehi überfielen das palästinensische Dorf bei Jerusalem, töteten mindestens 100 Bewohnerinnen – darunter viele Frauen, Kinder und ältere Menschen – und verübten Plünderungen sowie sexuelle Gewalt. Deir Yassin war kein Einzelfall: Auch in anderen Orten wie Tantura (Mai 1948) kam es zu Massakern an Zivilisten, die bis heute dokumentiert und erforscht werden. Diese Gewaltakte waren Teil einer systematischen Strategie, die palästinensische Bevölkerung zu vertreiben und Platz für den neuen Staat Israel zu schaffen. Die Nakba war somit kein punktuelles Ereignis, sondern ein längerer, geplanter Prozess, der bereits vor der offiziellen Staatsgründung begann und durch gezielte Gewaltakte wie in Deir Yassin und Tantura geprägt war.
Für viele Palästinenserinnen ist die Nakba kein abgeschlossenes historisches Ereignis, sondern eine bis heute andauernde Erfahrung. Die fortgesetzte Vertreibung, Enteignung und Entrechtung – etwa durch Siedlungsbau, Hauszerstörungen und militärische Vertreibungen im Westjordanland und Gazastreifen – wird als „andauernde Nakba“ verstanden. Auch die massenhafte Vertreibung im Zuge aktueller Kriege, wie zuletzt im Gazastreifen, wird von palästinensischer Seite als Fortsetzung der Nakba bezeichnet. Heute sind etwa 5,9 Millionen Palästinenserinnen als Flüchtlinge registriert, viele leben seit Generationen staatenlos und ohne Rückkehrrecht. Diese Kontinuität der Vertreibung und Ausgrenzung wird im öffentlichen Diskurs häufig ausgeblendet, obwohl sie zentral für das palästinensische Selbstverständnis und die Gegenwart des Konflikts ist.
Kontextausblendung: Die ignorierte Vorgeschichte des 7. Oktober 2023
Ein zentrales Beispiel für Kontextausblendung ist die Berichterstattung nach dem Anschlag vom 7. Oktober 2023: In vielen deutschen Medien wurde der Angriff als völlig unerklärlicher Ausbruch von Gewalt dargestellt, der „aus dem Nichts“ gekommen sei. Es wurde explizit gefordert, auf eine Kontextualisierung zu verzichten – teils sogar wortwörtlich. So wurde etwa Slavoj Žižek auf der Frankfurter Buchmesse massiv kritisiert, als er von einem „Analyseverbot“ sprach und darauf hinwies, dass ohne die Berücksichtigung der Vorgeschichte keine ehrliche Analyse möglich sei. Prominente Stimmen wie der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker warfen ihm daraufhin vor, Terrorismus zu relativieren. Dabei wird systematisch ausgeblendet, dass die Bevölkerung im Gazastreifen seit Jahren unter einer extremen humanitären Krise, wiederholten Militäraktionen und einer umfassenden Blockade leidet. Zwischen 2006 und Oktober 2023 führte Israel zahlreiche Militäroperationen durch, darunter „Summer Rains“ (2006) mit rund 400 Toten und über 1.500 Verletzten, „Cast Lead“ (2008/09) mit etwa 1.400 Toten und über 5.000 Verletzten, „Pillar of Defense“ (2012) mit etwa 170 Toten und über 1.200 Verletzten, „Protective Edge“ (2014) mit über 2.200 Toten und mehr als 11.000 Verletzten sowie „Guardian of the Walls“ (2021) mit über 260 Toten und rund 2.000 Verletzten (alle Zahlen laut UN). Hinzu kommen zahlreiche kleinere Angriffe, regelmäßige Luftschläge und die Zerstörung ziviler Infrastruktur, die vom israelischen Militär pietätlos und entmenschlichend als „Mowing the lawn“ (Rasenmähen) bezeichnet werden. Besonders traumatisierend war der „Great March of Return“ (2018–2019), bei dem Zehntausende Palästinenser*innen friedlich an der Grenze protestierten; allein in dieser Zeit wurden laut UN über 200 Menschen getötet und mehr als 36.000 verletzt, viele durch Scharfschützenfeuer. Die demografische Realität verschärft das Leid zusätzlich: Über 65 Prozent der Bevölkerung in Gaza sind unter 25 Jahre alt. Eine ganze Generation hat ihre Jugend unter Blockade, in ständiger Angst vor Bombardements und mit dem Verlust von Angehörigen und Freunden verbracht. Für diese Menschen ist Gewalt, Zerstörung und Hoffnungslosigkeit Alltag – eine Vorgeschichte, die in der deutschen Debatte meist ignoriert wird. Dass all dies in einem aufgeklärten Land wie Deutschland kaum eine Rolle spielt, trägt dazu bei, die Ereignisse vom 7. Oktober als isolierten Akt von „Barbarei“ zu deuten und die tieferliegenden Ursachen und Traumata der palästinensischen Bevölkerung auszublenden.
Kontextausblendung: Palästinensischer Widerstand ohne Erwähnung von Leid und Verlust
In der öffentlichen Debatte bleibt meist unerwähnt, dass es sich bei den Palästinenser*innen um eine besetzte, entrechtete und unterdrückte Bevölkerung handelt. Wenn über palästinensischen Widerstand, Proteste oder Demonstrationen berichtet wird, liegt der Fokus häufig auf der Wut der Menschen oder auf umstrittenen Parolen, während der eigentliche Hintergrund ausgeblendet wird: Viele der Protestierenden haben bereits Angehörige durch israelische Angriffe verloren, leben in ständiger Angst um Freunde und Familie und erleben, dass zivile Opfer keine ernsthaften politischen Konsequenzen nach sich ziehen. Dieser Kontext wäre zur Einordnung des Protestverhaltens unerlässlich. Ohne ihn erscheinen Selbstbehauptung, Protest und Wut als irrational oder extremistisch, obwohl sie in Wahrheit Ausdruck jahrzehntelanger Unterdrückung, Gewalt und Perspektivlosigkeit sind. Angesichts dieser Erfahrungen ist es bemerkenswert, wie friedlich die Demonstrationen verlaufen – gerade auch im Wissen darum, dass Deutschland Israels Militär mit Rüstungsgütern unterstützt und dessen Vorgehen öffentlich als „Selbstverteidigung“ verteidigt. Die Ausblendung dieser Realität verzerrt die Wahrnehmung des Konflikts und verhindert ein echtes Verständnis für die Motive und das Leid der palästinensischen Bevölkerung.
Kontextausblendung: Dämonisierung statt historischer und politischer Einordnung der Hamas
Wir wollen keine Anwälte der Hamas sein, aber für eine seriöse Debatte ist es wichtig, zentrale Kontexte nicht auszublenden.
Die Hamas wird im öffentlichen Diskurs meist ausschließlich als radikalislamische Terrororganisation präsentiert. Dabei wird oft unterschlagen, dass die Hamas nicht nur militärisch, sondern auch politisch und sozial aktiv ist: Sie betreibt Schulen, Krankenhäuser und Wohlfahrtseinrichtungen und hat sich wiederholt an die UN und andere internationale Akteure gewandt, um auf die humanitäre Lage in Gaza aufmerksam zu machen oder Unterstützung zu erbitten. Wegen ihrer Einstufung als Terrororganisation bleibt sie jedoch international weitgehend isoliert.
Häufig wird ausgeblendet, dass die Hamas in ihren Anfangsjahren (bis etwa 1993) keine gezielten Angriffe auf israelische Zivilisten durchführte, sondern sich auf Widerstand gegen die Besatzung und soziale Arbeit konzentrierte. Erst nach dem Massaker von Hebron 1994, bei dem ein israelischer Siedler 29 Palästinenser tötete, begann sie mit Selbstmordanschlägen und rechtfertigte diese als „Gleichgewicht des Schreckens“. Auch ihre Angriffe auf Israel, etwa Raketenbeschuss aus Gaza, werden selten im Zusammenhang mit vorhergehenden Ereignissen wie israelischen Militäraktionen, Blockaden oder Eskalationen im Westjordanland betrachtet. Die jeweiligen Anlässe – etwa Tötungen palästinensischer Zivilisten, Hauszerstörungen oder Einschränkungen der Bewegungsfreiheit – werden im öffentlichen Diskurs meist nicht erwähnt.
Ein weiterer oft ausgeblendeter Aspekt: Die Hamas hat 2017 in einem neuen Grundsatzpapier erstmals die Gründung eines palästinensischen Staates in den Grenzen von 1967 akzeptiert – ein Schritt, der als faktische, wenn auch nicht explizite, Anerkennung Israels gewertet werden kann. Dennoch wird sie weiterhin ausschließlich als unversöhnlicher Akteur dargestellt.
Diese Reduktion auf das Terror-Narrativ blendet die politischen, sozialen und historischen Hintergründe der Hamas systematisch aus und verhindert eine differenzierte Auseinandersetzung mit ihrer Rolle im Nahostkonflikt. Indem diese Kontexte ausgeblendet werden, fällt es leichter, die Organisation zu dämonisieren und die militärische Härte Israels zu legitimieren. Und nein: Kontextualisierung bedeutet nicht, Gewalt zu entschuldigen!
Kontextausblendung: Das Völkerrecht als blinder Fleck in der Nahostdebatte
Das Völkerrecht bildet einen unverzichtbaren Kontext für die Bewertung des Nahostkonflikts, wird in der öffentlichen Debatte jedoch meist ausgeblendet. Dabei sind die rechtlichen Vorgaben eindeutig: Die Besatzung und Siedlungspolitik Israels im Westjordanland und in Ost-Jerusalem wurden vom Internationalen Gerichtshof (IGH) und von den Vereinten Nationen wiederholt als völkerrechtswidrig verurteilt. Auch die umfassende Blockade des Gazastreifens, die der Zivilbevölkerung lebenswichtige Güter wie Nahrung, Wasser, Strom und medizinische Versorgung entzieht, verstößt klar gegen das humanitäre Völkerrecht. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte und zahlreiche Menschenrechtsorganisationen betonen, dass das gezielte Aushungern von Zivilisten, die kollektive Bestrafung und die Verweigerung humanitärer Hilfe als Kriegsverbrechen zu werten sind.
Israel bleibt als Besatzungsmacht völkerrechtlich verpflichtet, die Versorgung und den Schutz der palästinensischen Bevölkerung sicherzustellen. Verstöße gegen diese Verpflichtungen – etwa durch unverhältnismäßige Angriffe auf zivile Infrastruktur, die Blockade lebensnotwendiger Güter oder die Anwendung von unterschiedlichem Recht für Israelis und Palästinenser in den besetzten Gebieten – sind nach internationalem Recht nicht zulässig. Dennoch werden diese Fakten in der deutschen Berichterstattung und Politik häufig ausgeblendet oder relativiert. Stattdessen dominiert das Narrativ von „Selbstverteidigung“ und „Terrorismusbekämpfung“, ohne die klaren Grenzen und Verpflichtungen des Völkerrechts zu benennen.
Gerade in einem Land wie Deutschland, das sich dem Schutz des Völkerrechts verpflichtet sieht, ist diese Ausblendung ein besonders eklatantes Beispiel für Kontextlosigkeit und verhindert eine ehrliche und fundierte Auseinandersetzung mit der politischen und moralischen Verantwortung im Nahostkonflikt.
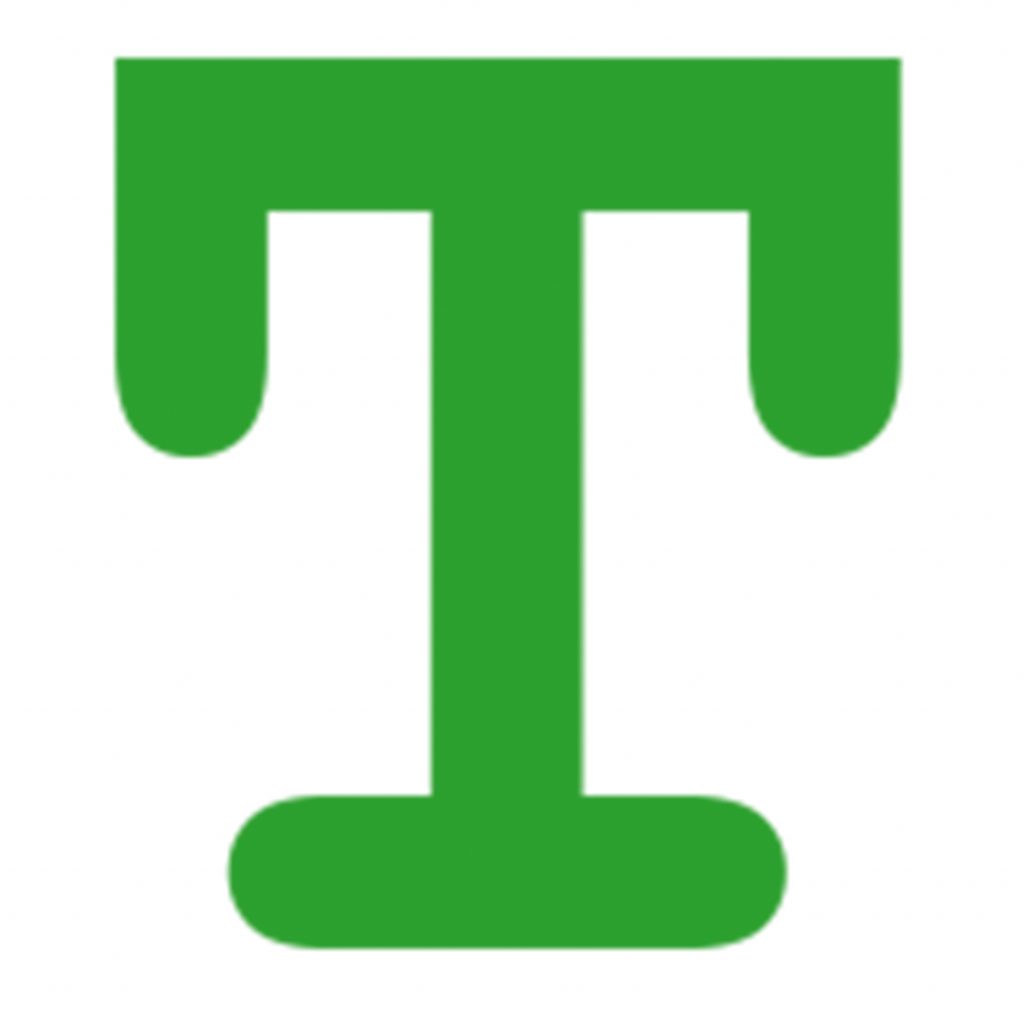
Taboo Enforcement / Tabuisierung
Kritische Begriffe, Vergleiche oder Analysen werden gezielt stigmatisiert, um sie aus dem öffentlichen Diskurs zu verbannen.
Beispiele für Tabuisierung
Tabuisierung: Die zionistische Ideologie hat eine rassistische Komponente
Ein besonders sensibles Tabu in der deutschen Debatte ist die Verbindung von Zionismus und Rassismus. Dabei ist historisch belegt, dass die zionistische Ideologie, wie viele nationale Bewegungen des 19. Jahrhunderts, von den damals in Europa verbreiteten rassistischen und kolonialistischen Denkmustern geprägt war. Führende Zionisten wie Theodor Herzl, Chaim Weizmann, Arthur Ruppin, Wladimir Jabotinsky und David Ben-Gurion äußerten in ihren Schriften und politischen Konzepten immer wieder Vorstellungen, die aus heutiger Sicht als rassistisch und entmenschlichend zu bewerten sind. Die Forschung, etwa von Nurit Peled-Elhanan, zeigt, dass sich diese Haltungen bis heute in israelischen Schulbüchern und im politischen Diskurs widerspiegeln. Auch aktuelle entmenschlichende Äußerungen von Regierungsmitgliedern und Militärs sind keine neue Entwicklung, sondern fügen sich in eine lange Tradition antiarabischer Ressentiments ein, die von Beginn an Teil der zionistischen Ideologie war und bis heute ist. Die Strategie, eine jüdische Bevölkerungsmehrheit durch Landnahme und Vertreibung der arabischen Bevölkerung zu schaffen, ist ohne diese ideologischen Grundlagen kaum erklärbar. In Deutschland jedoch wird jede offene Benennung dieser historischen und ideologischen Kontinuität sofort als Delegitimierung oder Dämonisierung Israels gewertet – ein Tabu, das eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Ursachen und Dynamiken des Nahostkonflikts massiv behindert.
Tabuisierung: Der Zionismus ist ein siedlerkoloniales Projekt
Der Zionismus weist in seiner praktischen Umsetzung von Beginn an alle Merkmale eines siedlerkolonialen Projekts auf. Schon die frühe zionistische Bewegung diskutierte verschiedene Zielgebiete – Palästina war nur eine von mehreren Optionen. Dieses Faktum entkräftet das gängige Narrativ, es habe sich primär um eine „Rückkehr“ in die angestammte Heimat gehandelt. Vielmehr suchten die Zionisten, ganz im Geist des europäischen 19. Jahrhunderts, nach einem geeigneten Territorium für ein jüdisches Gemeinwesen und entschieden sich aus politischen, strategischen und symbolischen Gründen letztlich für Palästina. Im Zentrum stand von Anfang an die Idee der Landnahme, verbunden mit dem Ziel, eine jüdische Bevölkerungsmehrheit zu schaffen – was zwangsläufig die Verdrängung und Marginalisierung der einheimischen palästinensischen Bevölkerung bedeutete. Andernfalls hätte das zionistische Projekt seinen Zweck verfehlt, denn als Minderheit hätte man auch in Europa bleiben können.
Bereits vor der Staatsgründung Israels zeigte sich diese Dynamik in der Praxis des Jüdischen Nationalfonds (JNF): Land wurde von arabischen oder osmanischen Großgrundbesitzern gekauft, und palästinensische Pächter und Bauern verloren dadurch ihre Lebensgrundlage. Der JNF untersagte es explizit, dass Nichtjuden auf dem erworbenen Land arbeiten durften – eine bewusste Strategie der Verdrängung und sozialen Marginalisierung. Nach der Staatsgründung 1948 kam es dann zur massenhaften Enteignung, Vertreibung und Entrechtung der palästinensischen Bevölkerung, als große Landflächen konfisziert und dauerhaft für jüdische Siedlungsprojekte reserviert wurden.
Ein zentrales Kennzeichen des Siedlerkolonialismus ist die systematische Marginalisierung der einheimischen Bevölkerung, die aus wirtschaftlichen, sozialen und politischen Ressourcen ausgeschlossen wird. Genau dies lässt sich in Palästina beobachten: Von Beginn an wurden Palästinenser*innen durch Landkäufe, Arbeitsverbote und Verdrängung benachteiligt; nach 1948 folgten Enteignung, Vertreibung und rechtliche Entrechtung im großen Stil.
Typisch für siedlerkoloniale Projekte sind auch die Legitimationsmythen, mit denen die eigene Präsenz gerechtfertigt wird. So wurde Palästina als „Land ohne Volk für ein Volk ohne Land“ dargestellt, die zionistische Bewegung stilisierte sich als „die Wüste zum Blühen bringend“ und als „Schutzwall gegen die Barbarei“ – letzteres eine Formulierung, die sich in verschiedenen Varianten im zionistischen und israelischen Diskurs findet. Bis heute wird Israel zudem als „einzige Demokratie im Nahen Osten“ präsentiert, was als Alleinstellungsmerkmal gegenüber der arabischen Bevölkerung dient. Solche Narrative dienen der Aneignung und Umdeutung von Geschichte und Raum und sind typisch für siedlerkoloniale Projekte.
Ein weiteres charakteristisches Merkmal ist die staatliche Förderung von Siedlungsprojekten, wie sie Israel bis heute betreibt – insbesondere im Westjordanland. Hinzu kommt die gezielte Tilgung und Umdeutung palästinensischer Geschichte: Wälder und Parks werden auf den Ruinen zerstörter Dörfer angelegt, palästinensische Ortsnamen verschwinden von den Karten, in Gaza wurden Universitäten zerstört und Friedhöfe geschändet. Diese Praktiken der Aneignung und Auslöschung sind international als klassische Elemente des Siedlerkolonialismus anerkannt.
Internationale Wissenschaftler*innen und Organisationen wie die UN, Amnesty International oder Human Rights Watch haben den siedlerkolonialen Charakter des Zionismus und der israelischen Politik vielfach belegt und analysiert. In Deutschland jedoch ist es ein großes Tabu, Israel als koloniales oder siedlerkoloniales Projekt zu bezeichnen – dies wird schnell als „Delegitimierung“ oder als „israelbezogener Antisemitismus“ gebrandmarkt. Diese Tabuisierung dient letztlich der Unterdrückung historischer und soziologischer Tatsachen und verhindert eine offene, wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzung mit den Ursachen und Dynamiken des Nahostkonflikts.
Tabuisierung: Das israelische Apartheidregime als Konsequenz der zionistischen Ideologie
Der Apartheidvorwurf gegen Israel ist seit Jahren Gegenstand internationaler Debatten und wird nicht nur von palästinensischen oder israelisch-kritischen Stimmen erhoben, sondern auch von prominenten Persönlichkeiten wie dem ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter, südafrikanischen Anti-Apartheid-Experten, israelischen und jüdischen Wissenschaftlern sowie von führenden Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch. Besonders hervorzuheben ist, dass Amnesty International in seinem umfassenden Bericht von 2022 Israel nicht nur in den besetzten Gebieten, sondern ausdrücklich auch innerhalb der international anerkannten Staatsgrenzen ein System der Apartheid attestiert. Amnesty argumentiert, dass seit der Staatsgründung 1948 Gesetze, Politik und Praxis darauf ausgerichtet sind, eine jüdische demografische Mehrheit zu sichern und jüdisch-israelische Kontrolle über Land und Ressourcen zu maximieren – mit systematischer Diskriminierung, Segregation und Entrechtung der palästinensischen Bevölkerung als Folge.
Die rechtlichen Grundlagen für den Apartheidbegriff finden sich in der Internationalen Konvention zur Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid von 1973. Diese definiert Apartheid als „unmenschliche Handlungen“, die in der Absicht begangen werden, die Vorherrschaft einer rassischen Gruppe über eine andere zu etablieren und aufrechtzuerhalten und sie systematisch zu unterdrücken. Zu den Kriterien zählen unter anderem: systematische Diskriminierung, Segregation, Einschränkung der Bewegungsfreiheit, Verweigerung grundlegender Rechte, Enteignung, Vertreibung und gezielte Verweigerung politischer, wirtschaftlicher und sozialer Teilhabe. All dies sind Aspekte, die sich aus dem siedlerkolonialen Aspekt des Zionismus quasi automatisch ergeben.
Auch der deutsche Völkerrechtler Kai Ambos hat 2024 in seinem Buch „Apartheid in Palästina?“ nach sorgfältiger juristischer Analyse festgestellt, dass der Apartheidvorwurf gegenüber Israel – insbesondere im Westjordanland, aber auch mit Blick auf die Situation innerhalb Israels – völkerrechtlich nachvollziehbar und keineswegs antisemitisch motiviert ist. Ambos betont, dass die völkerrechtlichen Kriterien der Apartheidkonvention auf die israelische Politik gegenüber den Palästinenser*innen anwendbar sind.
Trotz dieser klaren Faktenlage gilt der Apartheidvorwurf in Deutschland als schwerer Tabubruch. Selbst in Publikationen der Bundeszentrale für politische Bildung wird er häufig als Ausdruck von „israelbezogenem Antisemitismus“ abgetan, statt sich mit den menschenrechtlichen und völkerrechtlichen Argumenten auseinanderzusetzen. Diese Tabuisierung verhindert eine sachliche Debatte und blendet zentrale Aspekte der Realität im israelisch-palästinensischen Konflikt systematisch aus.
Tabuisierung: Der Genozidvorwurf gegen Israel
Der Vorwurf, Israel begehe im Gazastreifen einen Genozid, wird von zahlreichen internationalen und israelischen Stimmen erhoben – darunter Francesca Albanese (UN-Sonderberichterstatterin), Richard Falk, Norman Paech, Raz Segal, Ilan Pappé, Moshe Zuckermann sowie Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch. Während einige israelische Wissenschaftler wie Raz Segal den Begriff Genozid schon früh verwendeten, haben sich andere – etwa Moshe Zuckermann – angesichts der Eskalation in Gaza dieser Einschätzung angenähert.
Die UN-Völkermordkonvention von 1948 definiert Genozid als Handlungen, die mit der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören. Dazu gehören: Tötung von Gruppenmitgliedern, Verursachen schwerer körperlicher oder seelischer Schäden, Schaffung von Lebensbedingungen, die auf die physische Zerstörung der Gruppe abzielen, Maßnahmen zur Geburtenverhinderung sowie gewaltsame Überführung von Kindern in eine andere Gruppe. Nach Einschätzung zahlreicher renommierter Experten sind mindestens drei dieser Kriterien im Gazastreifen erfüllt: gezielte Tötungen, schwere körperliche und seelische Schäden sowie die Schaffung lebensfeindlicher Bedingungen – etwa durch systematisches Aushungern, Blockade von Hilfsgütern und Zerstörung von Infrastruktur.Nachdem Israel aber auch eine Fruchtbarkeitsklinik angegriffen und kryokonserviertes genetisches Material (Embryonen, Eizellen, Spermien) vernichtet hat, ist auch der Tatbestand der Maßnahmen zur Geburtenverhinderung relevant. Hinzu kommt, dass durch die Blockade von medizinischem Material Frauen gezwungen sind, unter extremen Bedingungen – oft ohne Narkose oder Medikamente – zu gebären.
Die Klageschrift Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) umfasst 84 Seiten und dokumentiert detailliert diese Vorwürfe. Sie enthält zahlreiche öffentliche Äußerungen führender israelischer Politiker und Militärs, die als Hinweise auf eine genozidale Absicht gewertet werden. Ergänzt werden diese Belege durch aktuelle Enthüllungen, wie etwa einen Haaretz-Bericht, in dem Whistleblower berichten, dass israelische Soldaten die Anweisung erhielten, gezielt auf Zivilisten an Nahrungsverteilungsstellen zu schießen.
Völkerrechtler wie Norman Paech und Kai Ambos betonen, dass die Tatbestände der Völkermordkonvention im Fall Gaza erfüllt sind; die juristische Debatte konzentriert sich im Kern auf den Nachweis der Zerstörungsabsicht.
Dennoch wird der Genozidvorwurf in Deutschland weiterhin tabuisiert und häufig als „antiisraelisches Narrativ“ oder „israelbezogener Antisemitismus“ abgetan, statt sich mit den menschenrechtlichen und völkerrechtlichen Argumenten auseinanderzusetzen. Diese Tabuisierung verhindert eine offene, faktenbasierte Debatte über die aktuellen Vorgänge und ihre rechtliche Bewertung.
Die IHRA-Definition: Instrument der Tabuisierung von Israelkritik
Ein zentrales Instrument der systemischen Tabuisierung von Israelkritik in Deutschland ist die sogenannte Arbeitsdefinition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Ursprünglich wurde diese 2016 als „nicht rechtsverbindliche Arbeitsdefinition“ verabschiedet, gedacht als Orientierungshilfe für Bildung und Forschung – nicht als juristisches oder politisches Regelwerk. Kenneth Stern, der damalige Leiter der IHRA-Kommission, distanzierte sich später ausdrücklich von der politischen Instrumentalisierung und Überdehnung der Definition und warnte:
„Die Definition war nie als Waffe gegen freie Meinungsäußerung oder gegen Kritik an Israel gedacht.“ (Stern, The Guardian, 13.12.2019)
Israel im Mittelpunkt des Antisemitismusdiskurses
Besonders problematisch: Von den elf IHRA-Beispielen für Antisemitismus beziehen sich sieben explizit auf Israelkritik (z.B. Dämonisierung, Delegitimierung, Doppelte Standards, Gleichsetzung mit Nazis, Bestreiten des Existenzrechts, Kollektivschuld, andere Maßstäbe). Damit wird Israel in den Mittelpunkt des Antisemitismusdiskurses gerückt. Die Bekämpfung des Hasses auf Juden, weil sie Juden sind, wird dadurch zur Nebensache erklärt. Deutschland hat 2017 als eines der ersten Länder die IHRA-Definition per Bundestagsbeschluss übernommen und sie sogar um eine „besondere Verantwortung“ und „Solidarität mit Israel“ ergänzt – ein Schritt, den kein anderes Land in dieser Form gegangen ist (BT-Drs. 18/11970).
Der 3-D-Test: Ein politisches Werkzeug
Die IHRA-Definition ist eng mit dem sogenannten „3-D-Test“ des israelischen Politikers Nathan Sharansky verbunden: Dämonisierung, Delegitimierung, Doppelte Standards. Diese Begriffe sind so vage, dass praktisch jede wissenschaftliche Analyse oder berechtigte Kritik an israelischer Politik als antisemitisch ausgelegt werden kann. Sharansky, oft als Menschenrechtler dargestellt, war in Wirklichkeit ein erzkonservativer Politiker, der sich stets gegen Kompromisse mit den Palästinensern stellte, zweimal aus Protest gegen Zugeständnisse zurücktrat und als Vorsitzender der Jewish Agency for Israel an der völkerrechtswidrigen Siedlungspolitik beteiligt war (Haaretz, 27.6.2018).
Wirkung in Deutschland: Ausschluss und Stigmatisierung
Die politische und gesellschaftliche Wirkung dieser Definition ist enorm: In Deutschland werden Vorwürfe wie Apartheid oder Genozid gegen Israel regelmäßig als „israelbezogener Antisemitismus“ diskreditiert – unabhängig von ihrer menschenrechtlichen oder völkerrechtlichen Substanz. Kritik wird so pathologisiert und eine offene Debatte systematisch verhindert.
Dass diese Strategie Wirkung zeigt, ist unbestreitbar: Namhafte Expertinnen werden aus öffentlichen Gebäuden und Veranstaltungen ausgeschlossen, erhalten kaum noch eine Bühne in den Mainstreammedien. Jüngstes Beispiel ist Francesca Albanese, die als UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete in Deutschland wiederholt ausgeladen oder diffamiert wurde. Doch auch jüdische und israelische Kritikerinnen sind betroffen: Die „Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost“, in der zahlreiche Jüdinnen, Juden und Israelis organisiert sind, wird inzwischen vom Verfassungsschutz beobachtet. Damit ist ein Punkt erreicht, an dem nicht nur palästinensische, sondern auch jüdische und israelische Stimmen systematisch aus dem öffentlichen Diskurs verdrängt werden – ein Grad der Tabuisierung, der international seinesgleichen sucht.
Ein westliches Definitionsmonopol
Interessant: Den Begriff des „israelbezogenen Antisemitismus“ gab es vor wenigen Jahren noch überhaupt nicht. Er ist eine deutsche und westeuropäische Erfindung der letzten zwei Jahrzehnte. Außerhalb dieser Regionen – insbesondere im Globalen Süden und in Asien – spielt er überhaupt keine Rolle. Insofern spiegelt er vor allem die politische Definitionsmacht Deutschlands, Israels und einiger westlicher Verbündeter wider.
Die Jerusalemer Erklärung: Eine differenzierte Alternative
Als Reaktion auf die problematische IHRA-Definition haben über 200 internationale, darunter viele israelische, Expert*innen 2021 die „Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus“ (JDA) veröffentlicht. Sie hält explizit fest:
„Kritik an Israel, auch scharfe Kritik bis hin zu Boykottaufrufen, ist nicht per se antisemitisch.“ (JDA, Grundsatz 14)
Die Jerusalemer Erklärung zeigt, dass es international – auch unter jüdischen und israelischen Wissenschaftler*innen – einen breiten Konsens für eine differenzierte, nicht-politisch instrumentalisierte Antisemitismusdefinition gibt.
Der FACT-Test versteht sich als Gegengift zum „3-D-Test“ von Nathan Sharansky und der IHRA-Antisemitismusdefinition, die jede ernsthafte Kritik an israelischer Politik und zionistischer Ideologie reflexhaft als „Delegitimierung“, „Dämonisierung“ oder „doppelte Standards“ abqualifizieren und zu einem dubiosen „israelbezogenen Antisemitismus“ aufbauschen. So werden Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen oder Journalist*innen pauschal des Antisemitismus bezichtigt – selbst dann, wenn ihre Aussagen menschenrechtlich fundiert und historisch belegt sind. Der FACT-Test entlarvt solche Mechanismen als unfaire und unwissenschaftliche Methoden, die dem Schutz eines politischen Narrativs dienen – nicht der Wahrheitsfindung.